Aktuelles
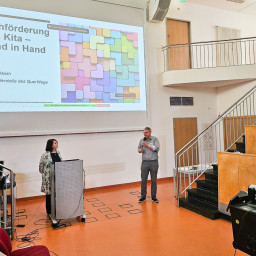
Gemeinsam stark für jedes Kind – Ein Rückblick zum Fachtag „Frühförderung und Kita – Inklusion braucht beide“
25.06.2025
Wasserspaß in Winzerla: QuerWege bei den Wasserachsenspielen 2025
12.06.2025

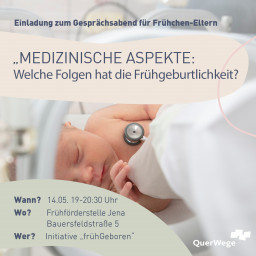
Herzliche Einladung der Initiative »frühGeboren« zum Gesprächsabend am 14.5.
07.05.2025
Einladung zum Gesprächsabend für Frühchen-Eltern am 12.3. zum Thema: »Geschwisterkinder«
28.02.2025
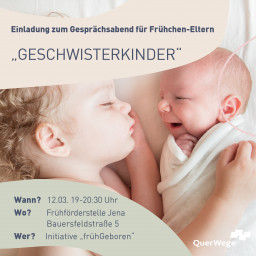

30–jähriges Dienst-Jubiläum der Kolleginnen der ersten Stunde
29.11.2024
Am 17. November ist Welt-Frühgeborenen-Tag
11.11.2024


Einladung zum Gesprächsabend 13.11.24, 19:00 – 20:30 Uhr
04.11.2024
Jubiläum der Frühförderstelle – Abendveranstaltung mit Vortrag von Markus Bach am 29.11. (mit Anmeldelink)
09.11.2023


„Eine Tür für Kommunikation öffnen“. Interview mit dem Arbeitskreis »Unterstützte Kommunikation«
25.07.2023
Unser neuer Flyer zum Download: Die Frühförderstelle auf einen Blick
23.02.2023


Gemeinsame Spielzeit – Der Spielkreis der Frühförderstelle
31.08.2021
Durch Spieltherapie Kinder stärken
26.10.2020
